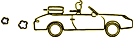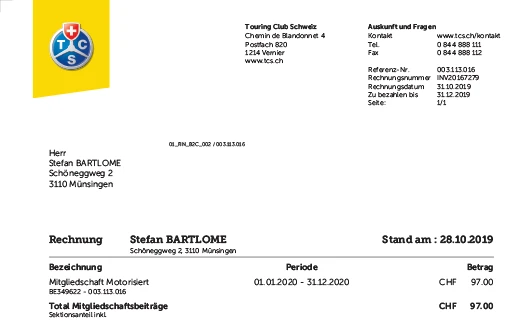
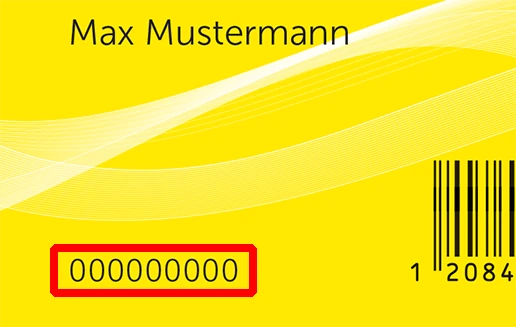
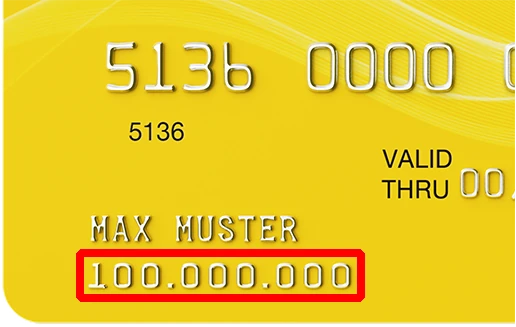
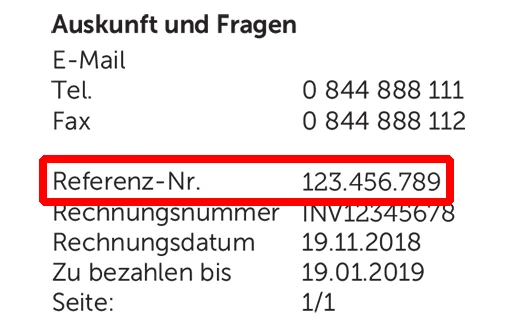
Es braucht Gesamtbetrachtung
Welche Verkehrspolitik bringt uns vorwärts? Da gehen die Meinungen auseinander. Der TCS bringt sich in die Diskussion ein und bezieht Position. Sektionspräsident Peter Schilliger zur Spange Nord, Tempo 20 auf Hauptstrassen und das Sorgenkind Stadt Luzern.
Was ist das zentrale Anliegen des TCS?
Peter Schilliger: Wir verlangen eine Gesamtmobilitätsstrategie, in der sich alle Mobilitätsteilnehmer ernst ge-nommen fühlen und die Mobilität auf allen Ebenen funktioniert – vom Autofahrer über die Busbenützerin bis zum Fussgänger. Alle sollen sich sicher bewegen können.
Ist eine solche Gesamtbetrachtung vorhanden?
In vielen Bereichen schon. Das grösste Problem lokalisieren wir im Zentrum der Stadt Luzern, wo der meiste Verkehr zusammenkommt. Dort entsteht das Gefühl, dass sich alles um das Velo dreht und alle anderen Verkehrsteilnehmer sich danach zu richten haben.
Beschäftigt die Verkehrspolitik der Stadt Luzern aktuell am meisten?
Ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Dazu gehört die angesprochene Bevorzugung von Velos, die bei Fussgängern beispielsweise in veloorientierten Begegnungszonen zu Unsi-cherheiten führt, aber auch die konsequente Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs. Es findet zudem ein schleichender Abbau von Parkplätzen im Zentrum statt, ohne dass eine Kompensation stattfindet. Vor allem aber ist die Durchquerung des Zentrums nicht gewähr-leistet. Mit dem aktuellen politischen Weg will sich die Stadt für Autofahrer unattraktiv ma-chen.
Denken Sie dabei auch an den Bypass und die Spange Nord?
Ja. Ich verstehe die Anliegen der Bewohner in den betroffenen Quartieren und es braucht eine tragbare Lösung. Aber es ist eine Tatsache, dass ein Verkehrsaufkommen vorhanden ist und die Autobahn und das Stadtzentrum entlastet werden müssen. Die Stadt hat folgende Grundhaltung: Es gibt sowieso keine Lösung, also leisten wir auch keinen Beitrag. Das ist blockierend und nicht lösungsorientiert.
Was schlagen Sie vor?
Man muss offen sein gegenüber der Gesamtauslegeordnung des Kantons, die aktuell läuft und die der TCS unterstützt. Später soll unter Einbezug der Quartiere nach Lösungen gesucht werden.
Wie steht der TCS zu Tempo 30 Zonen auf Hauptstrassen?
Eher kritisch. Es gibt Strassen, die für die überregionale Erschliessung bestimmt sind und das sind meistens die Hauptstrassen. Es ist keine Lösung, nur die Kapazität in einer Gemeinde zu reduzieren ohne eine Umfahrung zu bieten. Horw hat dies beispielsweise vorbildlich erreicht: Tempo 30 im Dorfzentrum und Umfahrungsmöglichkeiten.
Bern geht bereits einen Schritt weiter und will eine Begegnungszone mit Tempo 20 auf einer Hauptverkehrsachse. Ihre Haltung dazu?
Das ist keine Lösung. Der Verkehrsfluss und der damit verbundene Verkehrsabfluss sind für eine funktionierende Mobilität zentral. Mit Tempo 20 auf Hauptverkehrsachsen wird der Ver-kehrsfluss massiv gestört und ein Umfahren durch Quartiere – wo notabene Tempo 30 gilt – zur attraktiveren Variante. Übrigens: Mit Tempo 20 wird der ÖV ebenfalls massiv benachtei-ligt.
Welche Chance geben Sie der Anti-Stau-Initiative der Jungen SVP, welche die Sektion im Grundsatz unterstützt?
Alle haben ihre Rechte: Velofahrer, Fussgänger und der öffentliche Verkehr, aber eben auch der motorisierte Individualverkehr. Er hat ein Recht, dass gewisse Kapazitäten erhalten blei-ben. Wie jede Initiative geht sie vermutlich einen Schritt zu weit. Aber dass die Initiative das Thema auf die politische Agenda bringt, begrüssen wir sehr.
Wie und wo kann die Sektion Waldstätte die politische Agenda mitgestalten?
Wir arbeiten in verschiedenen Gremien wie der Luzerner Mobilitätskonferenz mit und nehmen an Vernehmlassungen teil. Wir sind in der ganzen Region sehr gut vernetzt und im Austausch mit Verbänden, Behörden und der Wirtschaft. Im Weiteren leisten wir auch mit unserer TCS-Verkehrskonferenz einen Beitrag zur Diskussion.
Ohne dabei nur als Autoclub wahrgenommen zu werden.
Das ist uns ganz wichtig. Wir verstehen uns als Verfechter einer Gesamtbeurteilung und ste-hen für ein Miteinander aller Mobilitätsformen ein. Darauf baut die TCS Politik. Wir wollen ein Sprachrohr sein für alle, die sich eine solche Gesamtbetrachtung wünschen. Dass wir weit mehr als ein Autoclub sind, zeigt sich auch daran, dass wir uns aktiv für die Verkehrssicher-heit aller Verkehrsteilnehmer einsetzen, etwa mit Schulungsmaterial, Leuchtwesten für Kinder und einem breiten Kursangebot. In diesen Kontext passt die Tatsache, dass die Zahl der Mitglieder ohne den Leistungsteil «Pannenhilfe» von Jahr zu Jahr steigt.
Was wünschen Sie sich vom Diskurs bei verkehrspolitischen Themen?
Eine Versachlichung der Diskussion und dass alle Interessenvertreter, von der Auto- bis zur Velolobby, eine Gesamtbetrachtung vornehmen. Alle müssen akzeptieren, dass es verschie-dene Bedürfnisse gibt. Man muss dem grossen Mengengefüge des motorisierten Individual-verkehrs Beachtung schenken und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr interessant machen. Es geht nicht darum gegen den öffentlichen Verkehr oder Velos zu sein. Im Gegenteil. Es ist ein grosser Mehrwert, wenn man Verlagerungen erreicht, aber diese sollen nicht über Verbote erzwungen werden.
09:00 – 18:00 Uhr
(telefonisch ab 08:00 Uhr)